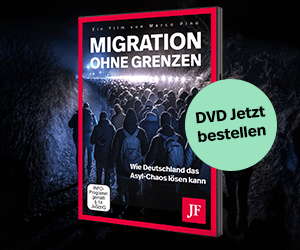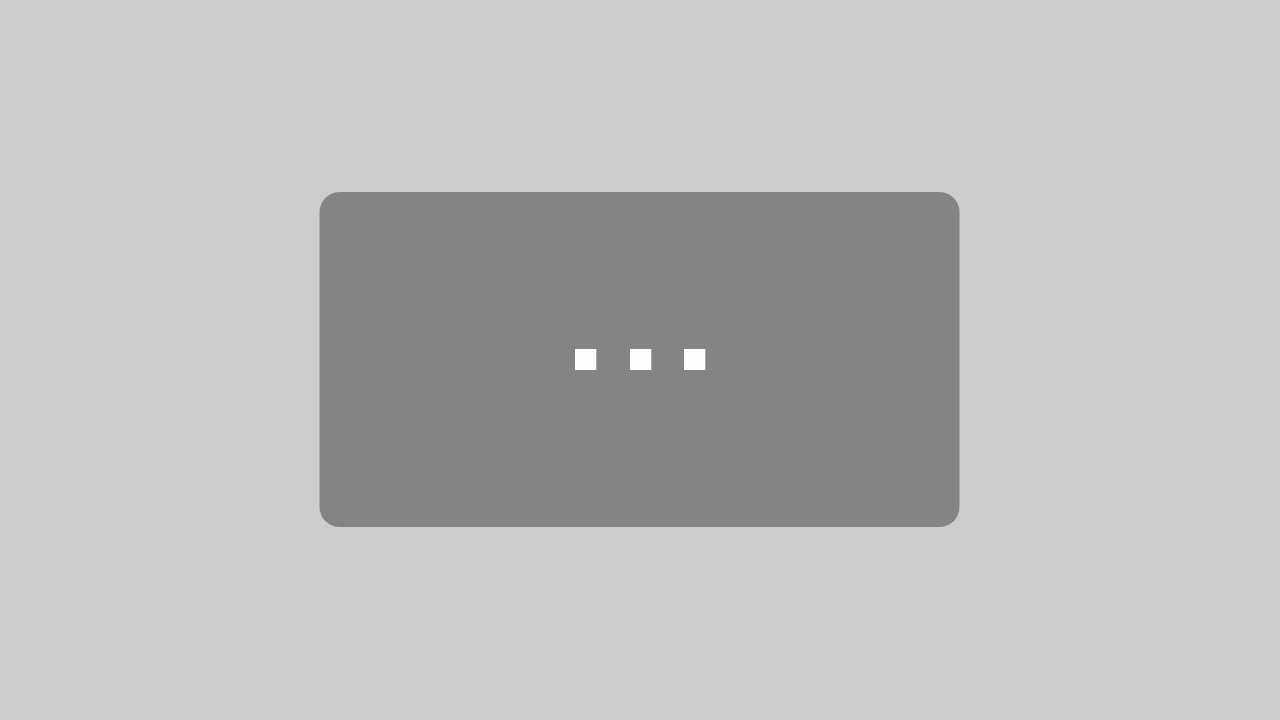„Ein ‚Magical Negro‘ ist eine schwarze Nebenfigur, die nur dazu dient, einen weißen Protagonisten ins rechte Licht zu setzen.“ Mit dieser eingeblendeten Erklärtafel eröffnet Kobi Libii seine sozialkritische Romantikkomödie „The American Society of Magical Negroes“.
In dem Schauspieler aus Los Angeles hat es lange Zeit kräftig rumort, und das merkt man seinem Debüt als Regisseur auch deutlich an. „Es ist zwar nicht die einzige problematische Figur in der Filmgeschichte“, sagt Libii, „aber die Symbolik des Magical Negro hat mich immer besonders beunruhigt. Schwarze Menschen haben nur insofern einen Wert, als sie das Leben eines weißen Protagonisten bunter oder sinnvoller machen, sie haben keinen eigenen Wert. Hier spiegelt sich ein dunkles Bild der allgemeinen Werte unserer Gesellschaft: Das Leben von Schwarzen ist nicht immer wichtig“.
In der dem magischen Realismus verpflichteten Gesellschaftssatire wird Aren Mbondo (Justice Smith), ein aufstrebender, allerdings glückloser Künstler, nach seinem demoralisierenden Mißerfolg bei einer Ausstellung von Roger (David Alan Grier), einem mysteriösen Abgesandten der titelgebenden Geheimgesellschaft, dazu überredet, dieser beizutreten. Die „American Society of Magical Negroes“ hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben ihrer weißen Mitbürger zu verbessern, um die Bedrohung für Schwarze auf ein Minimum zu reduzieren. „Je glücklicher sie sind, desto sicherer sind wir“, lautet Rogers Wahlspruch. Im Hintergrund des Films steht also die Überzeugung, daß Menschen wie Aren, Menschen mit dunkler Hautfarbe, in den USA prinzipiell Opfer eines strukturellen Rassismus sind. Das ist analytisch unscharf, subjektiv nehmen das aber viele Farbige so wahr.
Der Weiße ist der Bösewicht
In einer Harry-Potter-ähnlichen Parallelwelt, in der die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Vision verschwimmen, kommen die „Negroes“ zusammen, um sich gemeinsam auf ihre Überzeugungen einschwören zu lassen: Immer schön Ja sagen. Ja nicht aus der Rolle fallen. So eingeschworen auf eine erfolgreiche Existenz frei von weißen Repressalien, stürzt sich Aren ins Berufsleben und fängt bei der Internet-Plattform Meetbox an. Den Maximen der Vereinigung gemäß will er auf keinen Fall etwas anderes sein als der Karrieresteigbügelhalter seines weißen Kollegen Jason (Drew Tarver).
Blöderweise hat der aber auch ein Auge auf Firmenschönheit Lizzie (An-Li Bogan) geworfen. Und mit der hatte Aren kurz zuvor in einem kleinen Café einen flüchtigen Flirt, den er nun, da er weiß, daß Lizzie und er Kollegen sind, gern fortsetzen würde. Wird sich das aber mit der strikten Philosophie der „American Society of Magical Negroes“ vereinbaren lassen? Als Jason die Maske fallen läßt und die Fratze eines „weißen Suprematisten“ zum Vorschein kommt, und das auch noch parallel zu einer sexistischen Haltung gegenüber Lizzie, schlägt die Stunde der Entscheidung.
Eigentlich ist es ja die Todsünde jedes künstlerisch Tätigen, seine Kunst in den Dienst der Politik zu stellen. Selten hat sich ein Film derart viel Mühe gegeben, den Anspruch, etwas anderes sein zu wollen als ein politisches Pamphlet, konsequent zu negieren: Vor dem Start von Libiis Regiedebüt in dieser Woche wurde der Presse eine Erklärung des Filmemachers zugänglich gemacht, in der er seine Motivation – vielleicht sagt man besser: Mission – erläutert: „Die Grundidee der satirischen Komödie ist ziemlich einfach: Was wäre, wenn es ein echter Job wäre, ein Magical Negro zu sein? Was wäre, wenn dein ganzes schwarzes Leben davon bestimmt wäre, weißen Menschen und weißem Komfort Priorität einzuräumen? Was wäre, wenn du jeden Morgen aufstehen würdest und dich darauf konzentrieren müßtest, die Version von dir selbst zu sein, die in eine weiße Welt paßt […]? Natürlich ist das absurd und übertrieben, um den Film zu einer Komödie zu machen. Offensichtlich verhalten wir uns nicht so.“
„Magical Negroes“ ist Selbsttherapie des Regisseurs
Aber wenn er ehrlich ist, „wirklich ehrlich“, schiebt Libii nach, dann muß er zu seiner Pein zugeben: „Ich kann mich in der Jobbeschreibung des Magical Negro wiederfinden.“
Denn eine Sache, die ihm die Gesellschaft beigebracht habe, so der Regisseur weiter, sei es, sich anzupassen: „Die Lehrer ermutigten mich, meine Sprache anzupassen. Ich tat es. Sie kontrollierten meine Noten, meine Zukunft. Mein Vater hat mir beigebracht, bei jedem Kontakt mit der Polizei unglaublich nett und nicht provokativ zu sein. Er, der seine Jugend in einem Amerika verbracht hatte, in dem es noch Lynchmorde gab, machte mir die Dringlichkeit der Angelegenheit erschütternd deutlich: Mach dir keine Sorgen um deinen Stolz, mach es nur der mächtigen weißen Person recht.“ Und so dürfte Libiis eigener Vater Pate gestanden haben bei der Figur des engelsgleichen Roger, des Mentors und Agenten der Organisation, die den schwarzen Minderwertigkeitskomplex zur Regel erklärt.
Natürlich darf man Bauchschmerzen haben bei einem so schematischen selbsttherapeutischen Ansatz für einen Film, der gleichwohl ein breites Publikum erreichen soll. Ohne in Abrede stellen zu wollen, daß die subjektiven Erfahrungen des ehemaligen Studenten der Theaterwissenschaften an der Eliteuniversität Yale ein berechtigter Anlaß für Empörung sind, ist doch die Frage, wie gut so viel Aufarbeitungsbedarf einem Filmkunstwerk tut. Gerade die Thesenpapier-Monologe während der Versammlung der „Magical Negroes“ erinnern doch eher an szenische Lesungen aus dem Agitprop-Zeitalter, wirken wie ein Rückfall in die Ära, in der selbst hochdekorierte und international gefeierte Poeten die Mao-Bibel für Literatur hielten.
Die unnötig langen und teilweise ermüdenden Szenen, die eigentlich nur den Zweck haben, möglichst viele, oft ironische Begriffe für die These von der internalisierten Selbstverleugnung des schwarzen Mannes in einer von Weißen dominierten Gesellschaft zu finden, rauben „The American Society of Magical Negroes“ die Zeit für filmästhetisch Wertvolleres. Immerhin: Sie gewähren Einblicke in die verwundete schwarze Seele Amerikas, den Nährboden der gewaltbereiten „Black Lives Matter“-Bewegung. Man begreift, wie deren Vorkämpfer ticken.
Kritik an Großkonzernen dürfte deftiger sein
Erst als er sich der nüchtern-authentisch erzählten Romanze zuwendet, die sich zart zwischen Aren und Lizzie anbahnt und mit Nebenbuhler Jason zur klassischen Dreiecksbeziehung wird, findet der Film seinen Rhythmus und wird zum Hingucker. Am Ende geht es wieder mal nur darum, wer „das Mädchen bekommt“, wie es Libii ausdrückt. Er scheint es für eine Sensation zu halten, wenn das mal kein Weißer ist.
Auch das in der zweiten Filmhälfte stärker aufs Korn genommene Angewanze von Meetbox-Chef Mick (Rupert Friend) an den debilen Diversitätskult ist ein schönes Thema, aus dem zu spät zu wenig gemacht wird. Dem Tech-Unternehmen unterläuft eine Panne: Das entwickelte Programm schließt Schwarze aus der Gesichtserkennung aus und sorgt auf dem afrikanischen Kontinent für ein „Ghana-Gate“. Die Persiflage auf Mark Zuckerberg und sein Meta-Imperium hätte ruhig noch etwas deftiger ausfallen dürfen.
Denn Google, Amazon, Airbnb, Facebook & Co., die nach außen hin jedes Betroffenheitsritual in Form eines Kotaus bis unter die Grasnarbe mitmachen und gleichzeitig nach innen kalten Kapitalismus, profane Profitmaximierung und seelenlosen Selektionismus praktizieren, verdienen noch viel massivere Satire-Breitseiten, als sie Kobi Libii nach den vielen magischen, aber dramaturgisch wenig ergiebigen Szenen vom Anfang noch abfeuern kann.
———————————————–
Filmstart von „The American Society of Magical Negroes“ ist am 25. April.

Ich bin ein David im Tech-Blogger, Digital Marketing Profi seit 8 Jahren. Computeringenieur von Beruf und ich liebe es, neue Ideen zu finden, die die SEO von Websites verbessern. Ich teile gerne Wissen und Informationen zu vielen Themen. Mein Ziel ist es, die Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen und seine Gedanken zu teilen. Außerdem lese ich gerne und höre Musik.
Quellenlink : Filmbesprechung: Filmbesprechung Selbsttherapie in der „American Society of Magical Negroes”